Notes – Notizen zum Thema – anwachsend – piling up.
- Sie werden die Lieder nicht schreiben
VON KATERYNA KALYTKO, übersetzt von Chrystyna Nazarkewytsch
15
Не складуть пісень, бо діти їхніх дітей…
Sie werden die Lieder nicht schreiben, denn ihre Kinder
schrecken bei der bloßen Erwähnung in ihren Betten um vier Uhr
. . . . hoch,
betroffen vom bloßen Widerhall in ihrem Knochenmark.
Die Einzelteile des Todes ergeben kein Ganzes, immer wird es
an einem Viertel – vom Körper oder vom Schicksal – fehlen.
Die Landkarte ist an den Faltstellen zerfleddert.
Hoffnungslos verrostet die Haustür, dein Nachtwächter,
Jeder hat in der Morgendämmerung giftigen Speichel im Mund.
All die Aschenhaufen haben Namen und wiederholen ihre
dringenden Lockrufe wieder und wieder –
zu scharf, panischer Klage zu ähnlich, zu lang für ein Lied
über das zerhagelte Feld, das mit der Innenseite nach außen verkehrt
. . . . ist,
über die Schwarzerde, die Gott letztlich mit seinen Fingern
. . . . zerbröckelt. - Die Andersnamigkeit der Welt
In ihrem Essay FREMDSPRECHEN kommt Esther Kinsky auf die Andersnamigkeit der Welt zu sprechen. Zunächst trete uns die eigene Sprache deutlicher entgegen, beginnen wir mit der Unternehmung in sie, oder aus ihr heraus zu übersetzen. Viele unterschiedliche Merkmale kommen dabei ins Bewusstsein: “das Repertoire von Namen, Benennungen, Bezeichnungen, die in jedem Kopf eine durch Erinnerung, Erlebnis, Erfahrung andere und eigene Färbung haben und eingebettet sind in das vertraute Tempusraster zur Ordnun von Geschehen im Fluss der Zeit.” (Kinsky, 2013:43)
Wie komme ich zu einer Stimmigkeit zweiter Ordnung? Nähe ist oft nicht die Lösung.
“Die Grundvoraussetzung für jede Arbeit an Übersetzung”, schreibt Kinsky, “ist die Bereitschaft, sich auf eine Andersnamigkeit der Welt einzulassen und auf das damit verbundene, oft hoffnungslose Ringen um eine annähernde Kongruenz zwischen originalem und übersetztem Text. Diese Bereitschaft beruht nicht nur auf dem Interesse am anderen Klang und Namen, sondern auch an den Schattenrändern, Rissen und Klüften, die sich bei dem übersetzerischen Versuch auftun, zwei Sprachwerke zur Deckung zu bringen. Jeder Übersetzungsvorgang, der Text neben oder jenseits seiner bloßen Aussagefunktion als gestaltetes Material begreift, wird mit diesen Rändern, Rissen und Klüften mehr befasst sein als mit den Worten und Satzteilen, die sich einfach zu fügen scheinen, denn in den Deckungsungleichheiten, in den unvermeidlichen Divergenzen öffnet sich eine fruchtbare Welt der Infragestellung von Gegebenem, der Unterwanderung von Festgeschriebenem, der Eigenart von sprachlichem Leben.” (Kinsky, 2013:44)

Esther Kinsky spricht hier von einem fruchtbaren Bodensatz, von eher rauem Material. Ränder, Risse und Klüfte lassen sich an Gesteinsformationen denken.
Esther Kinsky: FREMDSPRECHEN. Berlin, 2013.
- Nichts anderes als bürokratische Xenophobie
Januar 2023: Der deutsche Politiker und CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat sich in der Debatte um die Silvester-Krawalle für eine Deutsch-Pflicht auf deutschen Schulhöfen ausgesprochen. „Es geht nicht, dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als Deutsch gesprochen werden“, sagte Czaja. „Ansonsten entstehen schon in den Schulen Parallelgesellschaften.“
Nils Minkmar kommentierte diesen Vorschlag in seinem Newsletter: Der siebste Tag: “In unserer Familie wurde schon immer über Politik gesprochen. Morgens wurde ich von lauten Stimmen geweckt, die die Zukunft des Sozialismus, die Dekolonisierung oder neueste politische Skandale debattierten.
Und nun überlege ich seit einigen Tagen, was mir so an besonderen Tiefpunkten in Erinnerung geblieben ist, denn ein Vorschlag des CDU-Generalsekretärs geht mir nicht mehr aus dem Sinn: die Deutschpflicht auf Schulhöfen. Kinder, die in der Pause kein Deutsch sprechen, sollen ermahnt und bestraft werden, so möchte der Mann die Silvestergewalt in Neukölln bekämpfen. Je länger ich darüber nachdenke, desto bewundernswerter ist dieses Juwel von einem Januarvorschlag: von allen Seiten falsch. Ich vermute, es ist der schlechteste politische Vorschlag meines Lebens.
Es ist ein großer Vorteil, wenn Kinder mehrere Sprachen sprechen können und man soll sie bei jeder Gelegenheit dafür loben. Dabei eine Wertung vorzunehmen – europäische Sprachen top, alle anderen Flop – ist diskriminierend und unsinnig. Wer – wie es in einer Stuttgarter Grundschule geschehen ist, eine Schülerin bestraft, weil sie in der Pause türkisch spricht, hat im Schuldienst nichts verloren. Es ist nichts anderes als bürokratische Xenophobie.”
Nils Minkmar in seinem Newsletter: Der siebste Tag
.
Hierzu auch eine Passage aus Olga Grjasnowas Essay “Die Macht der Mehrsprachigkeit”. Ausgehend von einem Artikel aus der Frankfurter Sonntagszeitung vom 26. Juli 2020, von Rüdiger Soldt mit dem Titel “Deutschpflicht”, über eine Schülerin, die gegen die Auflage ihrer Schule, auf dem Schulhof Deutsch zu sprechen, verstoßen hat und daraufhin eine Strafarbeit bekam, zieht Olga Grjasnowa weitere Schlussfolgerungen.
“Ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass der Artikel nicht geschrieben worden wäre, hätte die Schülerin Französisch gesprochen. Türkisch dagegen wird diskreditiert, wenn auch vielleicht nicht bewusst. Dennoch findet hier eine Abwertung der Herkunftssprache statt – und das auch noch in einem privaten Moment, nämlich beim Spielen und Sprachen während einer Unterrichtspause.
Man könnte in diesem Zusammenhang auch vom ‘Linguizismus’ sprechen – einer spezifischen Form des Rassismus, bei der Menschen, die eine bestimmte Sprache oder einen bestimmten Dialekt sprechen, diskriminiert werden, wie etwa Kurd’innen in der Türkei. Schon während der Kolonialzeit wurden Sprachen herangezogen, um die Unterlegenheit der Einheimischen zu begründen. Ihre Sprachen wurden als ‘primitiv’ abgewertet, im Gegensatz zu den ‘komplexeren’ westlichen Sprachen.
Dabei gibt es genügend historische Beispiele, die zeigen, dass es keine gute Idee ist, Kindern eine bestimmte Sprache an den Schulen zu verbieten. (…) Was all die genannten Beispeile [betreffend das Walisische im 19. Jahrhundert sowie die Bevorzugung des Englischen in den Britischen Kolonien und der Rotterdam-Code von 2006] gemeinsam haben, ist die Kränkung und Herabwürdigung ganzer Gruppen. Es ist eine Kränkung, die sich nicht so leicht vergessen lässt. Judith Butler, Philosophin und Begründerin der Gender Studies, stellt zudem fest: ‘Wenn die spezifische Kränkung, die jede_r von uns erlitten hat, sich als Teil eines Musters von Herabwürdigungen entpuppt, das im öffentlichen Diskurs reproduziert wird, und wenn sich dieses Muster zusätzlich als eines herausstellt, das eine vorherrschende Logik in Institutionen, einschließlich pädagogischer Institutionen, artikuliert, dann scheint es so zu sein, dass die Herabwürdigung nicht nur in meinem eigenen Leben Nachhall hat, sondern die soziale und politische Lebenswelt und ihrer Institutionen durchzieht.'” Soweit: Olga Grjasnowa: Lob der Mehrsprachigkeit. Über Herkunft und Vielfalt. Berlin 2021. Seite 69ff.
- Allez-y. IL FAUT LE FAIRE
Claudia Simma: ROH ÜBERSETZEN. Über „Fertigungs“-prozesse bei der Übersetzungsarbeit. Ein Vortrag am 11.01.2023 im IFK Wien und via Zoom. Hier ist eine HALBTREUE MITSCHRIFT davon.
Zuhause, vor meinem Rechner, via Zoom, am 11.01.2023, die meisten Kacheln sind gelöscht. Bei den wenigsten brennt Licht. Es beginnt. Gerade erschien: „Die sexuelle Differenz lesen“ – von Hélène Cixous, Jacques Derrida. Hg. von Anna Babka und Matthias Schmidt. Aus dem Französischen von Claudia Simma, die der Publikation auch eine “Übersetzungsfuge” zugesellt hat.
.
Simma sagt, eigentlich sei es nicht fertigzukriegen. „Ich kriege es nicht fertig.“ Der Text lässt sich nicht kriegen. Er will sich von der Übersetzung nicht fertig machen lassen. Im Widerstand sei das Textgebildet. Immer wieder lesen. Unübersetzbarkeit. Texte, die ihre eigene Geschichte nicht verwischen, nicht verdrängen.
.
Schreiben, das heißt Übersetzen.
.
Warum unünbersetzbare Texte übersetzen? Viele Antworten. Elemente ertasten. Die französische Sprache ist so lebendig, dass sie mir liebens- und lebenswichtig ist, sagt Claudia Simma. Bei der Übersetzung ins Deutsche, die besonderen Innenräume der deutschen Sprache ertasten, dabei ein so noch nie mögliches (nein, da hab ich mich verlesen), dabei ein so nah wie mögliches ungezähmtes Deutsch versuchen.
.
Der Titel: Die sexuellen Differenz lesen. Lektüren der sexuellen Differenz. Lectures de la difference sexuelle. Das alles mehrfach lesen. Der doppelte Genitiv: Wer liest wen? Lesarten der sexuellen Differenz. Die Artenvielfalt des Lesens. The Art of Reading. Die Kunst des Lesens. Ein so ungewöhnlich zappeliger Titel: Lesarten der sexuellen Differenz. Aber ein guter. Wo ist das programmatisch Wendige des französischen Titels hin? Entschuldigung, das hab ich überlesen.
.
Grammatische Vergleichbarkeit. Rohübersetzen – da, wo ein Text Widerstand leistet. Nicht ausbügeln, so lassen. Roh. Geglaubt. Crue. Cru. Die Vokabel, an die man glaubt, einer rohen, einer blutigen Sprache, einer Sprache toute crue, ganz roh. Dire la vérité toute crue. Toute cru, am liebsten vor Liebe verzehren, zum Fressen gerne.
.
Das Sprachdenken, wie das Denken sich denkt, nicht in aller Schwere wie Rodins Denker (kopfüber im Garten), es springt und rennt und flitzt und es ist ständig in Bewegung. Die Zeichensprache. Alles streicht aneinander vorbei und alles spielt, umspielt einander. „Die Texte lieben, die ich übersetze“, sagt Claudia Simma. Oder: „Die Texte leben, die ich übersetze.“ Das wäre eine weitere Lesart. Bewegliche Gelenke. (Das, was ich gestern schnell notiert habe, heute nicht mehr lesen können.)
.
Fußnoten. Ein schöner widersprüchlicher und so verzierter Saum. Fußnoten – sich einmischen. Besser nicht sich einmischen. Stand alone! Begleiten lassen. Die Kammer, in der alles noch einmal anders steht, betreten. Eine Lesart. Meine Lesart. Die sich ja sowieso nicht unterdrücken lässt, selbst in der Interpunktion. Die Aufmerksamkeit auf das lenken, was sich kriegen lässt. Der abgründige Gebrauch der Personalpronomen. Das Ereignis als Schrift – sich einander lesend nähern und entfernen. Wie Ameisen. Fourmis.
.
„Das Unmögliche ist unser Paradigma.“ Es ist an mir, mich an sie zu wenden. C’est mon tour, donc. Ich bin an der Reihe. Am Spiel. La parole. Le mot. Elle. Wer? Jemandem das Wort überlassen. Hélène me laisse, comme on dit, la parole. Elle me laisse. Sie lässt mich. Sie erlaubt mir. Sie verlässt mich. Sie überlässt (es) mir.
.
Schon die Kommasetzung ist ein Abenteuer. Ringen. Semantische, politsche, phallokratische und phallogozentrische Handlungsweisen. Und nicht damit fertig werden? Oh, ich kann das Schlusswort nicht mehr lesen. Es endet auf – igkeit. Ich kann meine eigene Schrift nicht – lesen. – igkeit. Verzeihung.
.
Kraft des Roughen. Die Rohfassung als Widerstand sichtbar machen. Bedauern, leichte Melancholie, für das getilgte Unfertige, das in der Revision Verschwundene. Das in den Fußnoten Gerettete.
.
Und was ist mit dem Unmöglichen? Allez-y. IL FAUT LE FAIRE.
.
[Eine halbtreue Mitschrift des Vortrags ROH ÜBERSETZEN von Claudia Simma, am 11.1.2023 im IFK, Wien]
- Die Verwechslungen hören nicht auf.
Kate Briggs beschreibt in ihrem Buch “This little Art” folgende Szene: In einem Übersetzungsseminar wird unter Anleitung einer Studentin Original und Übersetzung eines Textes miteinander verglichen, nur hatte die Studentin die beiden Texte zuvor absichtlich vertauscht. Die Teilnehmer’innen des Kurses lasen also ein Stück englische Prosa, die ihnen als Übersetzung (aus dem Französischen) präsentiert worden ist. In Wirklichkeit war es umgekehrt: Die französische Fassung war die Übersetzung, das englische Original wurde mit deutlicher Übersetzungskritik überzogen. Leichte Beschämung war die Reaktion auf die Enthüllung des Tricks.
“Everyone was a bit flushed and affronted, quickly backtracking when the trick of the exercise was revealed. Which suggests that rather than testifying to any identifiable quality of the prose itself, the categories of ‘original’ and ‘translation’ act more like placeholders: ‘original’ and ‘translation’ are the names for the positions we put writing in, and for the histories of writing labour we then assign to them (first-time writing, second-time writing). Positions which can then orientate and determine, in quite striking ways, the way the writing gets read. As in the sequence which closes Anne Carson’s Nay Rather, an essay on translation, where the familiar stops and signs from the London Underground, collected and sequenced, are thereby pronounced a translation of the Greek poet Ibykos’s fragment 286; and, on the facing page, the lines taken and set out from pages 136-7 of Conversations with Kafka by Gustav Janouch are likewise thereby pronounced a translation of that same fragment; and, turning the page again, so too are the words lifted from pages 17-18 of The Owner’s Manual of her new Emerson 1000w microwave oven. Carson calls this – the project of ‘translating a small fragment of ancient Greek lyric poetry over and over again using the wrong words’ – not exactly an exercise in translating, nor even an exercise in untranslating, but more like a ‘catastrophizing of translation’. She also calls it ‘a sort of stammering’.”
.
Briggs, Kate (2021): This Little Art. Aus dem Englischen von Sabine Voß. Zürich: INK Press.
Ann Carson (2013): Nay Rather. The Cahier Series no. 21. Londen: Sylph Editions.
- Into written English
This is a quote from the Translator’s Preface, by Matthew Moore, that opens the book: Opera Buffa. Poems by Tomaž Šalamun, translated of course by Matthew Moore.
.
“So what, OK, what is a poetry translation into written English? Poetry translation into written English needs the translator to provide the discrete language that goes against written English, literal translation, and correct word choice; the discrete language that deems unpoetic what a poems’s reader would presume written English needs. Silly written English dependencies on propriety and property, such as grammar that always agreesm sentences that are always complete, and total structural integrity; all of which has nothing to do with poetry. Poetry translation into wirtten English must reside in the poem-heart, and in poem-time, to provide the indifference of poetry with dicrete language to get a poem through the difference in languages alive. Written English is rarely discrete, unless it omits, or condenses. Written English likes to explain, with words. Why, saying it, I notice, why wouldn’t be the time to do away with the unpoetic habits in written English? Why, yes: now’s the time! Poetry translation into written English only needs a translator to accept the moods of histories and the genealogies of allusions behing poetry. I don’t know Slovenian. I don’t think you need to train in languages to translate a poem very well. Just accept a poems’s discrete language, keep several dictionaries and grammar books open on the desk as you work; after that, you have just to accept all of the coming critiques.”
From: Translator’s Preface by Matthew Moore, in: Tomaž Šalamun: Opera Buffa. Boston, Chicago: Black Ocean, 2021. - ALLE SEIN – Republik der Übersetzer’innen
Am 22. September findet in Berlin im Maison Français die NACHT DER ÜBERSETZUNG statt. Lesungen, Gespräche, Experimente, Workshops zur Frage des kollektiven Übersetzens. Die Frage lautet: “Kann Übersetzung einen gemeinsamen imaginären Raum entstehen lassen?”
- Politisches Theater übersetzen
Die Initiative DRAMA PANORAMA, das forum für übersetzung und theater e.v. – beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wie sich politisches Theater in der Übersetzung verändert.
The initiative DRAMA PANORAMA, das forum für übersetzung und theater e.v. – is currently dealing with the question of how political theater changes in translation.
Hier ein Ausschnitt aus der Ankündigung: “Was ist das Politische an einem Theatertext? Sind es seine Themen, seine Sprache, die Kontexte, in denen er zur Aufführung kommt? Fragen, die sich insbesondere die Übersetzerinnen politischer Dramatik stellen. Antworten geben sie in Form ihrer Übersetzungen. Beides, Fragen und Antworten, politische Theatertexte und ihre Übersetzung, stehen im Mittelpunkt der kommenden Veranstaltungen unserer Reihe panorama #2: übertheaterübersetzen sowie einer in Kürze im Neofelis Verlag erscheinenden neuen Anthologie.”

DALL-E übersetzt: Schachtel auf dem Meer? Box over the Sea, by Tomaž Šalamun Here is a quote from their handout: What is political about a theatre text? Is it the themes, its language, the context in which it’s produced? These are questions that translators of political drama especially ask themselves. They give their answers in the form of translations. Both, questions and answers, political texts and their translations, will be the focus of our upcoming events as part of the series panorama #2: übertheaterübersetzen as well as of two new anthologies soon to be published by Neofelis.
Mehr über Workshop und Programm von Politisches Theater übersetzen (Ende September 22)
Read more about the workshop and the programme of Translating Political Theatre (end of September 22)
- Metempsychosis
“As I read the original work, I admire it. I am overwhelmed. I would like to have written it. Clearly, I am envious – envious enough to make it mine at all cost, at the cost of destroying it. Worse, I take pleasure in destroying the work exactly because it means making it mine. And I assuage what guilt I might feel by promising that I will make reparation – also, of course, by the knowledge that I do not actually touch the original within its own language.
The destruction is serious. Translating is not pouring wine from one bottle into another. Substance and form cannot be separated easily. (I hope we so not have to go again over the false dichotomy of les belles infidèles, which assumes one could be ‘faithful’ to a poem by renderling ugly or dull what it ‘says.’) Translating is more like wrenching a soul from its body and luring into a different one. It means killing. (…) There is no body ready to receive the bleeding soul. I have to make it, and with less freedom than in the case of the most formal poem on a given subject. I have to shape it with regard to this soul created by somebody else, by a different, though not alien, aesthetic personality.”Rosmarie Waldrop: The Joy of the Demiurge, in: Dissonance (if you are interested). University of Alabama Press 2005.
- [Un]translatables: Buchstäblichkeit
Aus dem Vorwort von Jeffrey Young zum Buch ANDES by Tomaž Šalamun, übersetzt von Jeffrey Young und Katarina Vladimirov Young, Boston 2016.
“All I know for certain is that, as translators, we heeded Šalamun’s advice to stay literal. We tried to stay as faithful as possible to what Šalamun wrote the way he wrote it.

DALL·E translated a line by Šalamun: board that loosened and opened, let us into the water. There were moments of untranslability when we had to take certain liberties, which Šalamun encouraged and approved, but for the most past, whenever we strayed from the literal path, we could inevitably end up on a road to nowhere and hat to retrace our steps back to the source, which is the line, the individual word or words, the modd, the syntax, the sound, and rhythm – all these components of language that Šalamun works with the way a painter works with oil and brushstrokes or a stonecutter works with chisel and stone. Or the way medieval mystics worked with language to tap pigeons from walls, to create ‘something from nothing,’ as Šalamun once described me in an interview, or as he writes in Andes‘s first poem, ‘Among the Chestnuts’, speaking of his ‘child’: ‘I made him out of / shadows and firmed him with / halva.”
.
“Or the reference in the poem ‘Hedgehog’ to the ‘ostrich with gabon’ we quizzed him on this and he admitted, sheepishly, ‘Oh yesm that doesn’t make any sense. But please leave it as it is.’ So there you go.’
- Can we switch to English? Auf Englisch?
Auf welche Brücken-Sprache einigt man sich wo? Which one is the language to agree on – and where? In Western Europe it’s basically English, often. In Westeuropa ist das häufig Englisch. Sometimes this seems to easy a choice. Sinthujan Varatharajah and Hilal Moshtari have been working on this problem: Exclusions in a cosmopolitan society. Sinthujan Varatharajah und Hilal Moshtari haben sich mit dieser Problematik beschäftigt.
Untenstehend die Ankündigung der Buchpräsentation, wie sie die Berliner Buchhandlung Pro qm verschickt hat. Read the announcement of the Book Releasy by Pro qm. Pro qm is in Almstadtstraße 48-50, D-10119 Berlin.
.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. Oktober um 19:30 Uhr in der Buchhandlung Pro qm statt. The Book Premier will take place on the 6th of October, at 7:30 pm.
.
Englisch in Berlin. Ausgrenzungen in einer kosmopolitischen Gesellschaft – Buchvorstellung mit Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah
Im Cafe in Kreuzberg oder im Vintage-Laden in Neukölln: Das kosmopolitische Berlin spricht selbstverständlich Englisch. Doch wie konnte sich die englische Sprache an diesen Orten durchsetzen? Wer spricht Englisch in Berlin und wer ist davon ausgeschlossen? Und wurden nicht noch eben Gruppen als Parallelgesellschaften stigmatisiert, die sich auf einer anderen als der deutschen Sprache unterhalten? In einem Instagram Live-Gespräch, das in diesem Band in erweiterter Fassung auf Deutsch und in englischer Übersetzung vorliegt, gehen சிந்துஜன் வரதராஜா (Sinthujan Varatharajah), politische*r Geograph*in, und مشترى هلال (Moshtari Hilal), Künstlerin, diesen Fragen nach. Sie decken dahinter liegende Doppelstandards und Kapitalinteressen der deutschen Mehrheitsgesellschaft auf, schaffen Bezüge zu Gentrifizierung und Asylpolitik und suchen nach Formen einer gerechten Kulturarbeit.
.
சிந்துஜன் வரதராஜா (Sinthujan Varatharajah) lebt als freie*r Wissenschaftler*in und Essayist*in in Berlin. Sie*er studierte Politische Geographie und arbeitet zu den Themen Staatenlosigkeit, Mobilitäten und (Ohn-)Machtsgeographien mit einem besonderen Fokus auf Infrastrukturen und Architekturen. Varatharajah war über mehrere Jahre hinweg für verschiedene Menschenrechtsorganisationen in London und Berlin tätig. Im September erscheint ihr*sein Debütroman “an alle orte, die hinter uns liegen” im Hanser Verlag.
.
مشترى هلال (Moshtari Hilal) ist Künstlerin, Forscherin und Kuratorin und lebt in Hamburg. Sie ist Mitbegründerin des Kollektivs AVAH (Afghan Visual Arts and History) und des Forschungsprojekts CCC (Curating Through Conflict with Care). In Ihrer Arbeit, die künstlerische ebenso wie diskursive Formate beinhaltet, beschäftigt sie sich mit Schönheit, Hässlichkeit, Scham und Macht. Hilal hat Islamwissenschaft studiert mit einem Fokus auf Gender, dekoloniale Studien und Kulturwissenschaft in Hamburg, Berlin und London.
.
“Englisch in Berlin” basiert auf einem Gespräch, das Hilal und Varatharajah im Februar 2021 live auf Instagram führten. Es ist Teil einer Gesprächsreihe, innerhalb der die beiden seit 2021 unterschiedliche Themen behandeln, wie etwa das deutsche Fernsehen, medizinischen Kolonialismus oder neue Formen des Faschismus. Mit ihrer Diskussion zum Thema Nazi-Erbe lösten sie eine intensiv geführte Debatte über materielle Kontinuitäten in Deutschland nach 1945 aus.
.
Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt.
Sinthujan Varatharajah, Hilal Moshtari
Englisch in Berlin. Ausgrenzungen in einer kosmopolitischen Gesellschaft
Wirklichkeit Books 2022 - Klauke dich Klauker!
Sie lesen eine Passage aus Franz Fühmann: Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens, aus dem Jahr 1973: “Im Seminar eine Diskussion über die Möglichkeit des Nachdichtens aus Sprachen, die man nicht oder nur sehr wenig spricht. Es scheint aussichtslos, einem Ungarn klarzumachen, dass man sich über auf ein solches Geschäft einlassen kann. Und doch liegt gerade hier die Möglichkeit einer echten Kollektivarbeit, denn die Übertragung eines Gedichtes ist ja nicht eine Sache zweier, sie ist ein Sache dreier Sprachen: der gebenden, der empfangenden und der Universalsprache der Poesie. Ein ungarisches Gedicht ist ja nicht einfach “Ungarisch”, es ist Ungarisch, und es ist ein Gedicht, und wenn das Ungarische ins Deutsche übersetzt ist, steht die zweite Übersetzung, die innerhalb des Deutschen, noch aus, und wenn sie von einem, der die Sprache der Poesie nicht versteht, zu leisten versucht wird, wird gewöhnlich auch die erste Übersetzung zerstört … Es ist dann eine Art Pidgin-Lyrisch mit Zügen von Pidgin-Deutsch …
Nein, hier ist, trotz der Besonderheit, dass diese drei Sprachen in der linguistischen Form nur zweier erscheinen, eine echte Arbeitsteilung zwischen dem Interlinearübersetzer und dem Nachschöpfer (kein gutes Wort, aber ich finde kein besseres) möglich und in gewissen Fällen, wie eben denen der Sprache kleiner Völker, sogar geboten. Es war ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt, und es ist gelungen; ein Dogma der Nachdichtungstheorie und -praxis ist umgestoßen; wir haben hier wirklich Neuland beschritten und die Möglichkeiten sozialistischen Verlagswesens ausgenutzt, aber das alles wird fast gar nicht beachtet.
Wenn die neue Grammatik die Entstehung dessen untersucht, was sie ‘wohlgeformte Sätze’ nennt, und zur Entscheidung darüber, was in einer gegebenen natürlichen Sprache ein wohlgeformter Satz sei, einen ‘kompetenten Sprecher’ einsetzt, so sondert sie (ihr ‘kompetenter Sprecher’) aus dem allgemeinen Sprachgebrauch doch grundsätzlich etwas aus, was man als ‘poeitsche Sprache in ihrer Gesamtmöglichkeit’ bezeichnen könnte. Dies ist natürlich ebensowenig ein Einwand gegen die Transformationsgrammatik, wie der Terminus ‘poetische Sprache’ in einem nur vulgärroamntischen Sinn (‘Shön!’ – ‘So poesievoll!’ – ‘Das Herz geht einem auf!’ – ‘Das ist noch Kunst!’ usw.) auszulegen wäre. In eine solche lingua poetica gehören auch grammatikalisch falsche, ja es können auch ganz sinnlose Sätze zu ihr gehören wie etwa ‘Klauke dich Klauker!’ aus Brechts Simone.”
Franz Fühmann: Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens. Rostock 1973.
- Wörtlichkeit und Hallraum
Halbtreue Mitschriften I
Auf dem Podium, von links nach rechts aus der Perspektive des Publikums: Marcel Beyer, Frieder von Ammon, Douglas Pompeu und Valentina die Rosa, LCB, am 27. August 2022, gegen 15:00 Uhr.
Wörtlichkeit und Hallraum. Das fröhliche Spiel mit sehr ernsten Themen. Ergebnisse des Übersetzerworkshops, Grundlage war Beyers Buch “Dämonenräumdienst”. Sehr ernste Scherze (Goethe). Immer wieder in andere Sprachen ausfransen. Bereits der Primärtext trägt Fransen. Krötigkeit, wie kommt das denn zustande? Es war offenbar zu wenig Kröte präsent in “toadie”: sich unterwürfig verhalten. Wo war die plastische Anschauung des englischsprachigen Ausdrucks? In Ermangelung jener Krötigkeit, tritt die gleichnamige Pferdekrankheit auf.
Merke: Plastizität, Anschaulichkeit, Hallraum.
Das Gedicht heißt: Fünf Rezepte gegen Krötigkeit. Ein anderes Gedicht: November. Das beginnt so: “Ich brauche morgens viel zu lange, / Bis ich mich fremdgeschrieben / habe. Wimmerlich bin ich / und wettervergesslich. Nachts // ging der Wind, ich lag und dachte / immerzu an meine Schuhe, / bedrängt und bang. (…)” – bis hierher.
Sich fremdschreiben: sei das nicht nahezu das Portrait einer Übersetzerfigur? Sich fremdschreiben, und, wie es am Endes des Gedichtes heißt: Vor Feierabend noch ein Gedicht zerstören.
Sprache als Medium und Material.
Wimmerlich – was ist das? Später im Gedicht: “Ein paar finstere // Manuskriptseiten weiter wimmert / das Holz, wimmert Gestein / die Haut verwimmert / wirft Blasen.” Auf der Reise nach einer Entsprechung dessen was mit “wimmerlich” gemeint ist, verlässt man die eigenen Sprache und kommt dann wieder zu ihr zurück. Hinein und hinaus. Zur Entschaffung, zur Verfassung, rückwärts in den kreativen Impuls hinein, aber auch wieder hinaus. Der Blick in die Parallelwelt (hier verlaufen leicht verblockte Korridore) – und andere Hallräume tun sich auf.
Zuweilen kommt es vor, dass einem als Übersetzerin auch die eigene Sprache nicht mehr wirklich nahe ist, man schaut die eigene Sprache von außen an. Die eigene Sprache von außen anschauen zu können, kann eine große Hilfe sein, wenn man sie auf eine andere (nicht mehr innerliche Weise) verwenden will.

Das Freibad Humboldthain, durch die Verfransungen einer fremden Sprache gesehen. Wimmerlich: das seien Vernarbungen im Holz. Oder ihr Klang. Kann das sein? Etwas mit Holz, sagten die Übersetzerler. Eine Stimmungsvolle Valenz. Es gibt Worte, die im Grimmschen Wörterbuch nur mit einer einzigen Verweisstelle erscheinen. “Knickwirten” gehört dazu, wenn ich richtig zugehört habe. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich: ein kaum übertragbares Lemma, dessen Bedeutung unbekannt ist.
Das Allsprachliche Wörterbuch des Alchemisten, von dem ich später bei Zwetschgenkuchen berichtete. Wie soll man jeweils etwas darin finden?
Crisspardissu. Wimmerlich auf portugieisch.
Dann trat Terézia Mora auf und lehrte uns, dass auch die Abwesenheit von Péter Esterházy Esterházy-förmig ist. Später: Die Brettersinnlichkeit eines vernagelten Schaufensters. Der intellektuelle All-Abend.
Mitgeschrieben von Monika Rinck
- Untranslatables: THE DUCK
When I translate a sestina from Icelandic, where soul and duck are homonymous, inhabiting the same word, and “önd” is used sometimes as duck, sometimes as soul, I have a problem.

Wenn ich eine Sestina aus dem Isländischen übersetze, worin Seele und Ente homonym sind, also das gleiche Wort bewohnen, und „önd“ mal als Ente, mal als Seele gebraucht wird, habe ich ein Problem.
.
Das Entenorakel
Die Ente fährt den Gabelstapler in den geheimen Garten.
Liebestolle Schnallen treiben am Rippenbogen entlang.
Jetzt bitte nicht husten. Verstecken Sie sich bei den Spaten.
Da, hinter dem Häuschen, in dessen Rücken der Kran aufragt.
Stadtumbau! Wir müssen die Leute schließlich unterbringen.
Die Ente rangiert den Stapler. Sie kann rückwärts fahren.
An Donnerstagen kann man das Entenorakel alles fragen.
Alles. Auch Todesdaten. Triagefragen. Germanische Sagen.
Kwaack, Krawtz, Kwak. Es gibt nichts, das Enten nicht verraten.
Allerdings verraten Enten all das in ihrer endogenen Entensprache.
Etwas anderes war in diesem Garten nun auch nicht zu erwarten.Monika Rinck, first published in MÜTZE, Spring 2020.
.
The duck oracle
The duck drives the forklift into the secret garden.
Lovely bitchy buckles drift along the ribcage.
Now please do not cough. Hide by the spades.
There, behind the cottage, in whose back the crane rises.
Urban development! After all, we have people to accommodate.
The duck maneuvers the forklift. It can drive backwards.
On Thursdays, you can ask the duck oracle anything.
Anything. Even death dates. Triage questions. Germanic sagas.
Kwaack, Krawtz, Kwak. There is nothing ducks do not reveal.
However, ducks reveal all that in their endogenous duck language.
Well, something else was not to be expected in this garden..
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), with small manual adaptations.
.

.
There is INDUCKTION and DEDUCKTION. Learn to differentiate. Die Inducktion geht von der Ente aus, die Deducktion kommt von der Ententheorie. Inducktion starts with the duck, Deducktion starts with theory and ends with the duck.
There is ENTELECHIE and there is DULCE DE LECHE. Learn to differentiate: The can of sweetened condensed milk is the Entelechie of Dulce de Leche. As simple as that.
- Rough Translation
Rough Translation ist ein Projekt, das sich mit Fragen der Übersetzung im weitesten Sinne beschäftigt. Rough Translation is a project that deals with questions of translation in the broadest sense.
It is a joint project by the Institutes of Language Arts and Transcultural Studies. It includes a series of readings and performances and a conference in April 2023. And it might even go on – since translation is an endless task.
dann sehr vieles erst im Verschwinden begriffen / dan heel veel pas in het verdwijnen begrepen / then very many realizations at vanishing point.
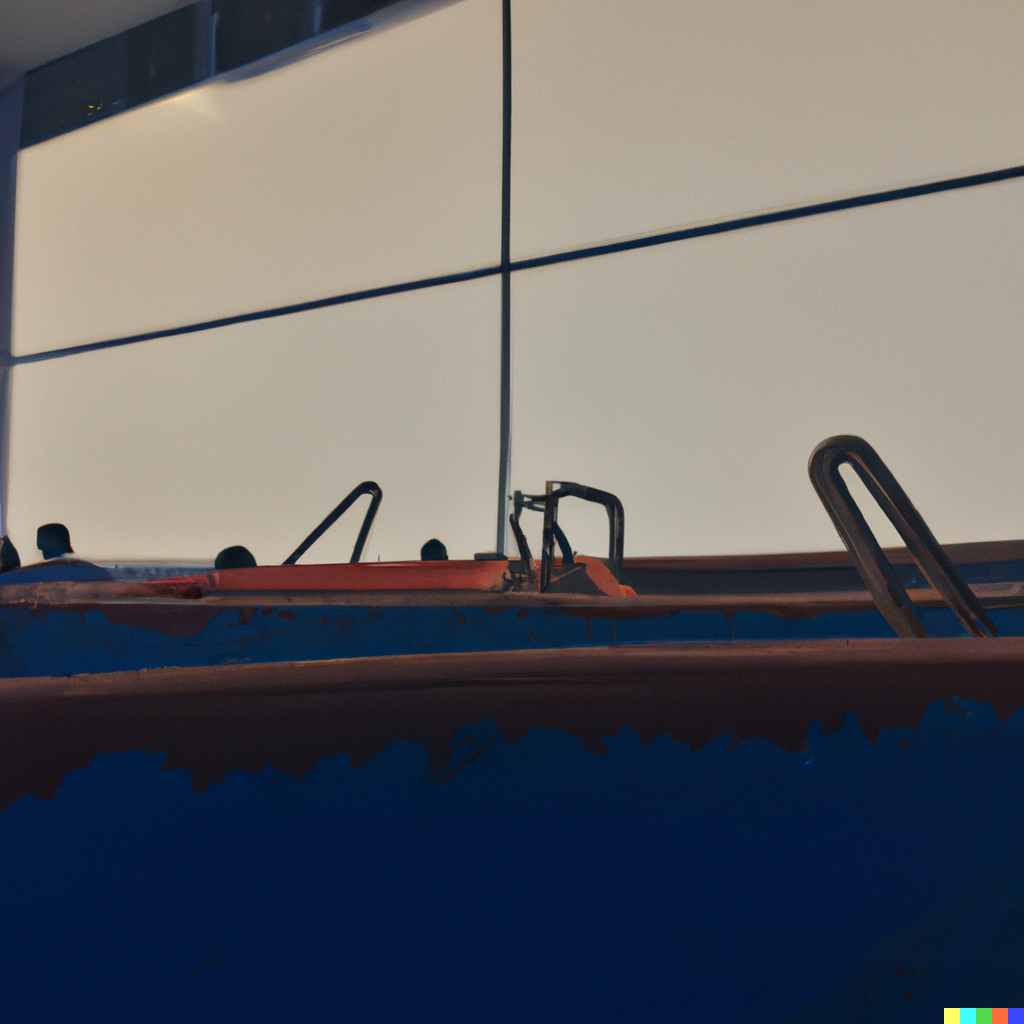
DALL·E translates: though I sang in my chains like the sea, with dolphin and ship